Nach einigen Worten zur Lage der Akademiker unserer Tage und die immer geringere Nachfrage nach Musikwissenschaftlern führe ich kurz aus, was mir beim Verfassen des vorletzten Beitrags in Bezug auf die Filmindustrie erst recht klar geworden sei: Der allgemeine Niedergang der Produktqualität der letzten Jahrzehnte habe seinen Ursprung im Sozialstaat, in der hohen Staatsquote. Und das gelte eben auch für die höhere Musik, die ja auch nichts anderes sei als ein qualitativ hochwertiges Produkt.
Für qualitativ hochwertige Produkte brauche es Käufer, sonst gebe es schlicht die Angebote nicht. Qualitativ besonders Hochwertiges sei aber immer Luxusgegenstand, also nur mit einer Schicht Menschen möglich, die genügend Geld besitze und zugleich groß genug sei, um eine kleine Industrie des Hochwertigen am Leben zu erhalten. Das sei letztlich auch der Gedanke bei Spengler, als er in Der Mensch und die Technik (Kultur… ist durch und durch Luxus) vom Luxus spreche.
Werde jedoch dieser oberen Mittelschicht ein genügend großer Teil der Kaufkraft entzogen, dann fehle es exakt an diesen Luxusausgaben. Genau das tue der Sozialstaat. Zwar sei das Geld dann lediglich bei anderen Menschen, aber eben bei den tendentiell Mindergebildeten. Wenn nun, wie im Falle der westlichen Staaten, 50% der Volkswirtschaft auf Staatsausgaben entfällt, dann seien das 40% der volkswirtschaftlichen Ausgaben mehr, als noch vor 100 Jahren, da die Staatsquote 10% betragen habe.
Diese 40%, die werweiß-wieviel Prozent der Einnahmen jener Schicht seien, fehlten bei den Ausgaben für anspruchsvolle Produkte, wie sinfonischer Musik, guter Literatur, werthaltiger Sachgüter usw. Stattdessen werde das Geld in den ungünstigsten Formen ausgegeben, von fremdem Geld für fremde Leute. Und was kauften Menschen, die nicht ihr eigenes Geld ausgäben und wüßten, daß sie es immer wieder bekämen und zugleich ja nicht einmal Geld sparen dürften? Das was ihnen kurzfristig den höchsten Nutzen bringe, nicht womit sie langfristig günstiger kämen. Das etabliere eine Kultur des minimalen Preises bei scheinbar erhaltenem Wert. Nur wenige Hersteller verblieben für die Reste der oberen Mittelschicht und stellten Qualitätsprodukte nach altem Muster her.
Der Witz daran sei nun, daß der Staat auf der anderen Seite diejenigen Menschen, die er mit Sozialstaatsmitteln ausgestattet habe, ständig erziehen müsse, was deren Kaufverhalten betreffe. Schließlich handle es sich bei dem Sozialgeld (das natürlich bis zum Kindergeld und Wohngeld, bis zur Eigenheimförderung hinaufreiche) um Mittel, die jenen Menschen unter normalen Umständen nie zur Verfügung stünden. Und bereits deshalb gäben sie es ganz unsinnig aus. They’re not used to it. Das knallharte Sparen würde deren Naturell nebenbei am besten entsprechen. Dann agierten auch diese Menschen nachhaltig, aus blanker Unmöglichkeit so zu konsumieren. So sei es früher eben gewesen. Stattdessen gebe es ekelhafte Bilder auf den Zigarettenschachteln, die uns Nichtraucher vermutlich mehr abstießen als die Raucher, rote Ampeln für zu fettige Fertigwaren usf. Aus dem Sozialstaat folge also am Ende auch der Nanny-Staat.
So fügten sich die ganzen Merkwürdigkeiten unserer Zeit sehr folgerichtig zusammen. Und allesamt seien sie eine direkte und unausweichliche Folge des Sozialstaates.
*
Wir kommen schließlich, wie beim letzten Male nur zu zweit, zur Musik. Aus mir nicht mehr erinnerlichen Gründen, legte Florian die dritte Fassung der Leonoren-Ouvertüre Beethovens auf, also den Vorläufer der Fidelio-Ouvertüre.
Als das Stück verklungen ist, sage ich, das sei mit das Schlechteste, das ich von Beethoven je gehört hätte. Da sei Kollege Cherubini vom letzten Mal deutlich überlegen gewesen. Florian schaut ganz verständnislos und will bereits die Fideolio-Ouvertüre zum Vergleich auflegen. Ich sage, hier sei alles zusammengestückelt, habe keine große Linie, es fehle an kompositorischer Stringenz. Florian behauptet, das sei keineswegs so. Das Stück sei genauso geschrieben, wie alles übrige Sonatenhafte bei Beethoven auch. Florian schlüsselt die Elemente der Sonatenform auf.
Ich sage, das möge sein, aber die Strukturen, von denen er rede, also jene, die das Stück als Ganzes in Abschnitte von mehreren Minuten gliederten, hätten ja nur einen sehr geringen Anteil an der Qualität eines Musikstückes im Allgemeinen. Eine gekonnte Gesamtlinienführung sei ja nur das i-Tüpfelchen, die goldene Turmspitze. Für ihn allerdings, entgegnet Florian, sei es das Fundament.
Ich führe aus, so wie die Satzfolge in einer Sinfonie, so sei die Sonate mit ihrem Aufbau ja bloß eine durchaus sinnvolle Form, die sich als besonders abwechslungsreich und folgerichtig herausgemendelt habe. Aber nur weil ein Stück dieser Form und ihren Abwandlungen genüge, werde es ja wohl noch lange keine gute Komposition. Das entscheidende sei doch, wie man diesen ausgenommen groben Rahmen fülle.
Im Zusammenhang mit einer kurzen Diskussion des Potpurri-haften der Beethoven-Ouvertüre (wie ich behaupte) legt Florian Adolphe Adams Danilowa-Ouvertüre auf. Ich sage, das sei ein wunderbares Beispiel des ganzen Gegenteils. Freilich, die Melodien seien recht einfach gestrickt, aber durchaus nett und die Übergänge zwischen den Themen geradezu meisterhaft ausgeführt, sodaß ich Florian an einigen Stellen bitte, zur Anschauung nochmals zurückzuspulen. Auch gebe es genügend Wiederholungen, den Fortgang anschaulich zu machen. Selbst Übergänge die ins Nichts führten seien als Kontraststöße stilsicher ausgeführt.
Aber um uns die Sache klar vor Augen zu führen, müßten wir uns damit auseinandersetzen, was diese größere Form sei – nicht daß wir aneinander vorbeiredeten. Und so bitte ich Florian, ein beispielhaftes Musikstück ausgefeilter Struktur zu nennen, das wir beide gut kennten, sodaß wir es als Vergleichsstück hernehmen könnten. Er nennt die Fünfte Beethovens.
Ich schmunzle etwas, und sage, er könnte doch nicht ernsthaft behaupten, das die Fünfte mit der Leonoren-Ouvertüre in ihrem ästhetischen Gesamtbilde irgendetwas wesentliches gemein habe. Da spiele er doch den advocatus diaboli. Ich folgere, also könnten wir zunächst festhalten, daß die Stücke einen sehr verschiedenen ästhetischen Eindruck machten. Bezüglich der melodischen Linienführung, der rhythmischen, derjenigen der Dynamik, der Instrumentierung, und freilich der harmonischen Folgen, seien die Stücke doch grundverschieden. Diese Einzelelemente (ohne Versicherung auf Vollständigkeit) müßten, um ein grandioses Stück Musik zu werden, so empfände ich, miteinander konsequent fortgeführt werden.
Das sei bei der Fünften zweifelsohne der Fall. Nun könne man aber ganz klar Stellen in der Leonoren-Ouvertüre benennen, wo das nicht geschehe. Etwa die Generalpausen, welche die Teile voneinander schieden, oder jene Stelle mit nichtssagendem Hintergrundgegrummel, einer völlig folgenlosen Steigerung und wieder Gegrummel mit dreingehauenen Orchesterschlägen. Ein Großteil des Stückes sei so aufgebaut. Wozu das Ganze? Ich sähe da keine Notwendigkeiten, daß die Musik gerade so geführt werden müsse. Florian erklärt, es handle sich dabei um etwas Überraschendes, was doch gut gelungen sei. Nebenbei hätten die Orchsterschläge sehr wohl einen Sinn. Sie stellten eine harmonische Entwicklung dar.
Das harmonische Moment akzeptierte ich vollkommen, gebe ich zu, aber genau dasselbe geschehe ja auch im Falle der Fünften. Dort aber involviere das nicht bloß Orchesterschläge, sondern den rhythmischen, melodischen, dynamischen Fortgang der Musik. Und deshalb sei das ganz andere Musik.
Außerdem habe er (Florian) hier einen ausgenommen treffenden Begriff eingeführt, nämlich den der Überraschung. Ich müsse zwar bemerken, daß es einen recht ärmlichen Versuch der Überraschung darstelle, in eine leise Umgebung einen erschreckenden Orchesterschlag zu setzen, aber für den Zeitstil könne man es vielleicht durchgehen lassen. Wesentlich interessanter sei jedoch die Tatsache, daß gerade das Moment der Überraschung in der Fünften im Gegensatz dazu überhaupt nicht vorkomme. Diese Musik sei nicht überraschend, also unzusammenhängend, sondern das ganze Gegenteil, nämlich vielschichtig ineinenander gebunden. Es gebe in der ganzen Sinfonie keinen einzigen überraschenden Moment. Eine Stelle aus dem Finale nennt Florian, sodaß wir dasselbe hören. Mir ist der genaue Punkt entfallen, allerdings einigen wir uns ohnehin, daß es mit dem „Überraschungseffekt“ der Leonoren-Momente nicht vergleichbar sei.
Während wir über Feinheiten im Fortgang des Satzes bei laufender Musik urteilen, beginne ich schließlich nochmals zu emphasieren, daß hier wirklich jede musikalische Entwicklung bis ins Detail vorhersehbar sei. Jeder noch so ungeübte Hörer könne trotz der – so seien wir uns ja einig – nicht ganz primitiven harmonischen Linienführungen, das Stück vorhersagen, ohne jedoch, daß es aus Langweiligkeit vorhersehbar werde, sondern, indem Rhythmus, Harmonien, Dynamik und Instrumentierung allesamt auf das Folgende hinwiesen. Ich erkläre, das liege eben exakt daran, daß alle genannten Elemente in diesem großen Entwicklungsspiel mitwirkten, nicht bloß die Harmonik einiger Orchesterschläge.
Und ich könne sogar ganz genau sagen, wie jene Stelle in der Leonoren-Ouvertüre entstanden sei. Machten wir uns doch nichts vor! Beethoven habe genau gewußt, wo er da harmonisch hinwollte, aber es sei ihm motivisch nichts eingefallen. Also habe er sich gesagt, um nicht weiter lange Töne zu ziehen, sondern etwas abwechslungsreicher fortzugehen, habe er eben die nötigen Akkorde, die er für den Weg zu jenem harmonischen Ziel brauchte, einfach rotzfrech als Orchesterschläge in ein paar ganz leise Streicherfloskeln hineingehauen. Fertig gewesen sei die Chose.
Weiter noch – und das sei doch hochinteressant – müsse er (Florian) doch zugestehen, daß die Fünfte überhaupt aus dem Schaffen Beethovens herausrage. Zwar sei jede Sinfonie Beethovens für sich ein Einzelstück, aber, so stimmt Florian zu, im besprochenen Sinne des Zusammenhangs aller musikalischen Eingenschaften sei die Fünfte ein Ausnahmestück.
Und das sei doch nun wirklich ungeheurlich: Da gebe es diese Unmenge an Kompositionen des Komponisten, aber eine steche so deutlich heraus, das man doch fragen müsse, was da mit Meister Ludwig losgewesen sei. Geradezu offensichtlich rage einem da die Frage nach der Qualität entgegen. Sei dieses Stück einmalig, weil es einmalig gut sei? Ich sagte Ja, aber fragten wir uns doch ganz logisch:
Sei es möglich, daß alle anderen Stücke primitiver seien? Wohl kaum, sonst hätte Beethoven hernach ja aus Überzeugung nichts mehr von anderer Art schreiben können. Sei die Fünfte schlechter als der Rest? Auch das sei unmöglich, denn Beethoven würde ein schlechtes Stück nicht als Sinfonie deklariert und ihm überhaupt eine Opuszahl gegönnt haben. Hinzu käme noch die persönliche Bedeutung des Stücks als Schicksalssinfonie. Wir hören im übrigen auch op. 90 als romantisches, fast Schubertsches Spätwerk.
Von identischer Qualität könnten sie aber auch nicht sein, denn dann wäre nicht zu erklären, warum es von der Sorte der Fünften nicht 20, 30 oder 50% im Schaffen des Meisters gebe.
Meine Antwort sei, daß Beethoven sehr wohl klar gewesen sei, daß die Fünfte ein Ausnahmestück darstelle und von einer kongenialen Selbstdurchdringung zeuge. Gleichwohl habe er gewußt, daß dergleichen am Fließband nicht zu produzieren möglich ist. Außerdem dürfe man nie vergessen, daß praktisch alle großen Komponisten zunächst Satztechnik, Kontrapunkt usw. gelernt hätten und daher starke Einflüsse aus diesem handwerklichen Teil des Komponierens mitgebracht hätten. Insofern sei eine handwerklich ordentliche Komposition immer als von Wert angesehen gewesen, obgleich sie derart ineinandergreifende Stellen nur teils hätte aufweisen können und nicht derart durchgängig, wie die Fünfte es tue.
Insofern glaubte ich, sei die Fünfte auch aus Beethovens Sicht ein qualitatives Ausnahmestück gewesen, wenngleich er noch kaum davon habe träumen können, daß dereinst jene Durchdringung auch ohne die auf ihre Weise monotone Gleichmäßigkeit der Fünften je würde möglich sein, nämlich im Schaffen Richard Wagners.
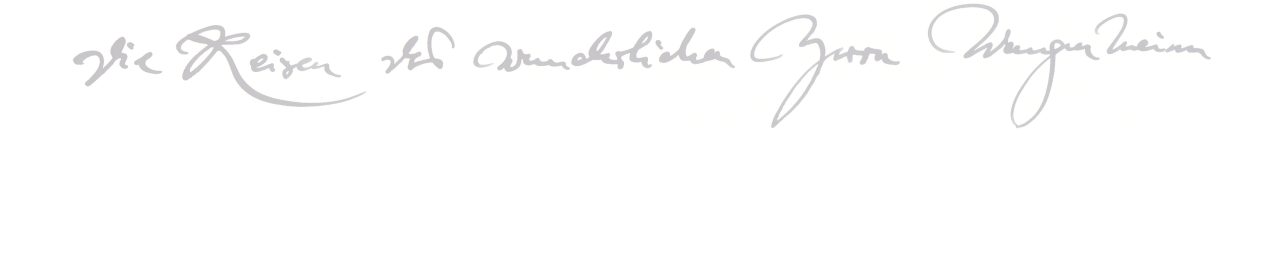
Zur Leonorenouvertüre kamen wir über das Kurkapellenwesen um 1900. Zur Illustrierung las ich einen Abschnitt aus Fritz Buschs ebenso lesenswerten wie amüsanten Erinnerungen „Aus dem Leben eines Musikers“ vor, in welchem er von seiner Zeit als junger Kurkapellmeister in Bad Pyrmont berichtet. Sein Vorgänger, so Busch, besaß eine einzige Partitur, die er nicht lesen konnte, da er gewohnt war, aus der Stimme der ersten Geige zu dirigieren. Diese eine Partitur war die von Beethovens Leonorenouvertüre. Daraufhin legte ich das Werk auf.
LikeLike
Natürlich! Wie konnte ich die herrliche Kurkapellen-Geschichte vergessen. Auch das verschwinden dieser kleinen Orchester war ja ein Anstoß, zu sagen, daß die Zahl der Musiker immer mehr schrumpft. Danke für Deine Ergänzung!
LikeLike
Pingback: Soirée russe . 06 Juli 2017 . Die Ouvertüre vom Barock bis Beethoven und ins russiche 19. Jahrhundert – Die Reisen des wunderlichen Herrn Wangenheim
Pingback: FDP vs AfD . Der Glaube des Liberalismus an ein Free Lunch durch Immigration – Die Reisen des wunderlichen Herrn Wangenheim